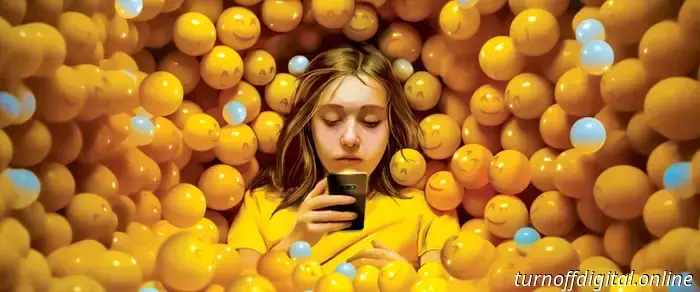
In einer aktuellen Rezension des New Yorker über Matt Richtels Buch „How We Grow Up“ fasst Molly Fischer effektiv die aktuelle Debatte über die Auswirkungen von Handys und sozialen Medien auf Teens zusammen. Fischer konzentriert sich insbesondere auf Jon Haidts Buch „The Anxious Generation“, das bislang 66 Wochen auf der Bestsellerliste der Times steht.
„Haidt verweist auf eine Auswahl an Statistiken aus angelsächsischen und nordischen Ländern, um zu suggerieren, dass steigende Raten jugendlicher Unzufriedenheit ein internationaler Trend sind, der eine internationale Erklärung erfordert“, schreibt Fischer. „Aber es ist möglich, andere Datenpunkte zu wählen, die Haidts Bild verkomplizieren – zum Beispiel sanken die Depressionsraten bei südkoreanischen Teenagern zwischen 2006 und 2018.“
Fischer weist auch darauf hin, dass die Selbstmordraten in den USA bei vielen Bevölkerungsgruppen steigen, nicht nur bei Jugendlichen, und dass einige Kritiker den Anstieg der Depressionen bei adoleszenten Mädchen auf bessere Screening-Methoden zurückführen (obwohl Haidt diesen Punkt angesprochen hat, indem er darauf hinweist, dass die Hospitalisierungen wegen Selbstverletzungen bei dieser Gruppe parallel zu den Diagnoseraten für psychische Erkrankungen steigen).
Die Art der Kritik, die Fischer zusammenfasst, ist mir als jemand, der häufig über diese Themen schreibt und spricht, vertraut. Ein Teil dieses Widerstands ist natürlich das Ergebnis von Posieren und Statussuchen, doch der Großteil scheint gut gemeint zu sein; die Abläufe der Wissenschaft, angetrieben von teils mehrdeutigen Daten, die durch Behauptungen und Gegenbehauptungen mahlen, zermürben die rauen Kanten und führen schließlich zu einer immer genaueren Annäherung an eine polierte Wahrheit.
Doch irgendetwas an diesem gesamten Gespräch hat mich zunehmend gestört. Ich konnte nicht genau benennen, was es war, bis ich Ezra Kleins Interview mit Haidt sah, das letzten April veröffentlicht wurde (Dank an: Kate McKay).
Es war nicht so sehr das Interview selbst, das meine Aufmerksamkeit erregte, sondern etwas, das Klein in seiner Einleitung sagte:
„Ich fand die Diskussion über [‚The Anxious Generation‘] immer ein wenig nervig, weil sie eine der Schwierigkeiten berührt, die wir beim Elternsein und in der Gesellschaft haben: die Tendenz, alles in die Sozialwissenschaft zu instrumentalieren. Es gibt kaum eine Sprache, um auszudrücken, dass etwas schlecht ist, wenn ich es dir nicht auf einem Diagramm zeigen kann.“
Dieses Phänomen ist für mich ein Zusammenbruch unseres Verständnisses davon, was ein gutes Leben ausmacht und was es bedeutet, als Mensch zu gedeihen.“
Ich denke, Klein bringt die Frustration gut auf den Punkt, die ich empfunden habe. In hochgebildeten Kreisen der Elite, in denen ich mich bewege, sind wir so conditioned von technischem Diskurs, dass wir unsere moralische Intuition zunehmend an statistische Analysen outsourcen.
Wir zögern, eine klare Position zu beziehen, weil wir fürchten, die Daten könnten zeigen, dass wir falsch lagen, was uns in einer technokratischen, totalitären Haltung desützen würde – wir lassen die Unordnung menschlicher Gefühle uns von der optimalen Vorgehensweise abbringen. Wir sind verzweifelt darauf bedacht, das Richtige zu tun – sprich: das, was am akzeptabelsten für unsere soziale/tribale Gemeinschaft ist – und brauchen eine schwatzende Expertenklasse, die uns versichert, dass wir es auch tun. (Siehe Neil Postmans unterschätztes Buch „Technopoly“ für einen viel intelligenteren Kommentar zu diesem kulturellen Trend.)
Bei Kindern jedoch können und sollten wir unsere moralische Intuition nicht aufgeben.
Wenn Sie sich unwohl fühlen angesichts der möglichen Auswirkungen dieser Geräte auf Ihre Kinder, müssen Sie nicht warten, bis die Wissenschaft Gemeinschaft eine Schlussfolgerung zu den Depressionsraten in Südkorea zieht, um Maßnahmen zu ergreifen.
Daten können aufschlussreich sein, doch vieles bei der Erziehung kommt aus dem Bauch. Ich halte es beispielsweise für keine gute Idee, meinem vors角lichen Sohn uneingeschränkten Zugang zu Pornografie, hasserfüllten Tiraden, langweiligen Videospielen und möglichst süchtig machenden Inhalten auf einem Gerät zu geben, das er überall in seiner Tasche tragen kann. Ich weiß, dass das schlecht für ihn ist, auch wenn es unter Sozialpsychologen noch Diskussionen über die statistischen Effektgrößen gibt, wenn Handystramas unter verschiedenen Regressionsmodellen untersucht werden.
Unsere Aufgabe ist es, unseren Kindern zu helfen, als Menschen zu „gedeihen“ (um Kleins Terminologie zu verwenden), und das ist ebenso sehr eine Frage unserer gelebten Erfahrung wie der Studien. Wenn es um Handys und Kinder geht, ist unsere moralische Intuition entscheidend. Wir sollten ihr vertrauen.
In einer kürzlichen Rezension des New Yorker über Matt Richtels neues Buch, How We Grow Up, fasst Molly Fischer die aktuelle Debatte über die Auswirkungen von Handys und sozialen Medien effektiv zusammen ... Weiterlesen